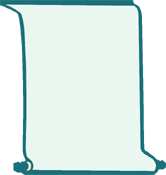Aufgabe 1: Bei der Nutzung von Diensten/ Geschäftsabwicklungen im
Internet fallen in der Regel personenbezogene Daten an.
Welche drei wesentlichen Rechtsvorschriften kommen dabei zum Tragen?
Lösung
Bei der Nutzung von Diensten / Geschäftsabwicklungen im Internet kommen drei
wesentlichen Rechtsvorschriften bzgl. des Datenschutzes zum Tragen:
-
TKG (Telekommunikationsgesetz):
- Rahmenbedingungen für die rein physische Datenübertragung
- Beispiel: ein Zugangs- Provider, der eine Internet- Verbindung anbietet
- Dürfen z.B. IP- Adressen langfristig gespeichert werden?
-
TMG (Telemediengesetz):
- Rahmenbedingungen für Internet- Dienste
- Beispiel: Einrichtung eines E-Mail- Postfachs auf dem Server
- Dürfen z.B. Kundendaten an Dritte weitergegeben werden?
-
BDSG (Bundesdatenschutzgesetz):
- Rahmenbedingungen für den Online- Kaufvertrag
- Rahmenbedingungen für bestimmte Verarbeitung personenbezogener Daten
(wenn nicht im TMG geregelt)
[Lösung schließen]
Welcher datenschutzrechtlichen Schicht ist TMG zuzuordnen?
Lösung
Aufgabe 2: Ein Service Provider will seinen Geschäftsbetrieb aufnehmen.
Bestehen Zulassungsbeschränkungen? Was beinhaltet der Begriff "Zulassungsfreiheit"?
Lösung
Nach §4 TMG sind alle Telemediendienste zulassungs- und anmeldefrei, d.h. ein Dienstleister
kann im Internet oder rund ums Internet seine Leistungen anbieten, ohne eine staatliche Zulassung
zu beantragen. Allerdings können andere Rechtsvorschriften (z.B. HGB oder GewO)
Zulassungsbeschränkungen vorsehen.
Bei dem Service- Provider käme noch in Frage, ob er möglicherweise an die
Beschränkungen des TKG gebunden ist, sofern er eine Übertragungsdienstleistung
(Zugang zum Internet, somit Telekommunikation) anbietet. Zusätzlich müsste er im
Sinne von GewO ein Gewerbe anmelden.
[Lösung schließen]
Aufgabe 3: Definieren Sie den Begriff "personenbezogene Daten". Welche drei Gruppen
personenbezogener Daten kennen Sie?
Lösung
Nach §3 Bundesdatenschutzgesetz sind personenbezogene Daten Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren
natürlichen Person.
Die personenbezogenen Daten können in größere Gruppen unterteilt werden:
persönliche Verhältnisse: z.B. Name, Geburtsdatum, Geschlecht
sachliche Verhältnisse: z.B. Kfz- Zeichen, Bankverbindung, Wohnort
Bestandsdaten: Daten, die für die Abwicklung des Vertrags erfasst werden müssen, z.B.
Art und Umfang der Leistung, andere vertragsspezifische Daten
Nutzungsdaten: Daten, durch die dem User der Zugang zu einem Anbieterdienst möglich wird,
z.B. Identifikations- und Zugriffsdaten
brechnungsdaten: Daten, die insbesondere für die Rechnungslegung nötig
werden, z.B. Anzahl und Dauer der Verbindungen, Bankverbindung
[Lösung schließen]
Aufgabe 4: Ein Online- Dienst verarbeitet die Daten seiner Kunden zu statistischen
Zwecken. Die Zustimmung der Kunden wird zuvor eingeholt. Ein Kunde widerruft die Zustimmung
mit sofortiger Wirkung. Außerdem verlang er eine Übersicht über die bisherige
Verwendung seiner Daten. Der Online- Dienst bestätigt den Widerruf zum Jahresende.
Zu welchem Zeitpunkt wirkt der Widerruf? Kann der Kunde eine Übersicht über die
Verwendung seiner Daten verlangen?
Lösung
Der Online- Dienst muss die statistische oder sonstige Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
ab sofort nach Zugang der Widerrufserklärung einstellen, und nicht erst zum
Jahresende wie angegeben. In dem Sinne müssen alle bisher erhobenen Kundendaten am gleichen
Tag vom sämtlichen Servern und Datenbanken gelöscht werden.
Grundsätzlich kann der Nutzer jederzeit vom Anbieter eine Auskunft über die zu
seiner Person oder seinem Pseudonym gespeicherten Daten verlangen, wobei der Anbieter diese
Auskunft unentgeltlich und unverzüglich erteilen muss. Insofern ist der Kunde natürlich
auch berechtigt, eine Übersicht über die statistische Verwendung seiner Daten
einzufordern.
[Lösung schließen]
Aufgabe 5: Nennen Sie vier Pflichten der Anbieter, wie Verbindungen mit
Nutzern inhaltlich gestaltet werden sollen?
Lösung
Nach §4 Absatz 2 Telemediendatenschutzgesetz (TDDSG) hat der Diensteanbieter durch
technische und organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, dass:
der Nutzer seine Verbindung mit dem Diensteanbieter jederzeit abbrechen kann,
die anfallenden personenbezogenen Daten über den Ablauf des Abrufs oder
Zugriffs oder der sonstigen Nutzung unmittelbar nach deren Beendigung gelöscht werden,
soweit nicht eine längere Speicherung für Abrechnungszwecke erforderlich ist,
der Nutzer Teledienste gegen Kenntnisnahme Dritter geschützt in Anspruch nehmen kann,
die personenbezogenen Daten über die Inanspruchnahme verschiedener Teledienste durch
einen Nutzer getrennt verarbeitet werden; eine Zusammenführung dieser Daten ist unzulässig,
soweit dies nicht für Abrechnungszwecke erforderlich ist.
[Lösung schließen]
Aufgabe 6: Kreuzen Sie bitte alle Rechte an, die grundsätzlich nur dem Urheber
eines Werkes zustehen.
Lösung
Vortragsrecht - Recht, ein Sprachwerk durch persönliche Darbietung
öffentlich zu Gehör zu bringen (§ 19, Absatz 1 UrhG)
Senderecht - Recht, das Werk durch Funk, wie Ton- und Fernsehrundfunk,
Satellitenrundfunk, Kabelfunk oder ähnliche technische Mittel, der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen (§ 20 UrhG)
Beurteilungsrecht
Widerrufsrecht
Ausstellungsrecht - Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke eines
unveröffentlichten Werkes öffentlich zur Schau zu stellen (§ 18 UrhG)
Meinungsfreiheit
Kopierrecht (= Vervielfältigung) - Recht, Vervielfältigungsstücke
des Werkes herzustellen, gleichviel ob vorübergehend oder dauerhaft, in welchem Verfahren
und in welcher Zahl (§ 16, Absatz 1 UrhG)
[Lösung schließen]
Aufgabe 7: Was können Sie unternehmen, wenn die Domain, die Sie haben möchten,
(z.B. Ihr Name), bereits belegt ist?
Lösung
Für die Vergabe der Domains in Deutschland ist die DENIC eG in Frankfurt zuständig.
Die DENIC registriert die Domains nach Prioritätsprinzip: "First come, first served".
Das bedeutet, dass im Falle mehrerer Antragsteller für die gleiche Domain demjenigen die
Domain zugewiesen wird, der als erster den Antrag gestellt hat.
In diesem Fall bleibt zunächst die Möglichkeit, eine andere Bezeichnung für
die Domain zu wählen. Auch kann man sich beim aktuellen Domaininhaber erkundigen, ob und ggf. unter
welchen Umständen er die Domain freigibt. Die Daten über die Domain und ihren Inhaber
werden bei der Registrierung in die whois- Datenbank der DENIC aufgenommen - diese Datenbank ist
öffentlich zugönglich.
Ansonsten besteht noch die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste zu setzen. Sofern die
gewünschte Domain frei wird, rutscht man in dieser Warteliste nach vorne.
[Lösung schließen]
Aufgabe 8: Ein Nutzer fordert per E-Mail ein Internetauktionshaus auf,
ihn nicht aufgefordert Newsletter zuzusenden. Muss das Auktionshaus die Zusendung
einstellen? Begründen Sie Ihre Antwort.
Lösung
Nach dieser Aufforderung müsste das Auktionshaus ab sofort die Zusendung der
Newsletter einstellen.
Gemäß dem Wettbewerbsrecht ist ein Direktmarketing (unmittelbare und individuelle
Einzelansprache von bestimmten Zielpersonen) in der Form, dass Werbung unaufgefordert an
E-Mail-Adressen versendet wird, nicht zulässig.
Auch muss der Nutzer zuvor ausdrücklich erklärt haben, dass er die Zusendung der
Newsletter möchte. Hat er das nicht getan, so war die Zusendung unaufgeforderter Werbung
von Anfang an wettbewerbswidrig und unzulässig.
[Lösung schließen]
Aufgabe 9: Was sind die Mindestbedingungen eines Vertrags?
Lösung
Damit ein Vertrag zustande kommt, müssen sich die beiden Vertragsparteien über den
Vertragsgegenstand und das dafür zu leistende Entgelt geeinigt haben. Dies geschieht durch
die Abgabe von zwei übereinstimmenden Willenserklärungen der Vertragspartner:
Angebot und Annahme.
[Lösung schließen]
Aufgabe 10: Nennen Sie ein Beispiel eines Vertrags, der schriftlich geschlossen
werden muss. Was ist die Rechtsfolge, falls das Schriftformerfordernis nicht beachtet wird?
Lösung
Damit der Rechtsverkehr nicht unnötig erschwert wird, können die Verträge
grundsätzlich mündlich geschlossen werden, wenn zwei übereinstimmende
Willenserklärungen (WE) abgegeben werden.
Nach Gesetzen her bedürfen einige Verträge einer schriftlichen Abgabe von WE und /
oder einer notariellen Beglaubigung. Gesetzliche Formvorschriften bilden im Rechtsverkehr die
Ausnahme, wobei hier vier Ziele verfolgt werden, um die Geschäftspartner zu schützen:
Warnfunktion - der Erklärende soll wegen der Risiken des Geschäfts vor
übereilten Bindungen geschützt werden, indem ihm seine Verpflichtungen schriftlich vor
Augen geführt werden
Beweisfunktion - die Form soll klarstellen, ob und mit welchem Inhalt das
Geschäft zustande gekommen ist und etwaige später aufkommende Erinnerungslücken -
etwa vor Gericht - verhindern
Beratungsfunktion - die notarielle Beurkundung soll darüber hinaus eine
sachkundige Beratung und Belehrung der Beteiligten sicherstellen
Kontrollfunktion - ausnahmsweise kann durch Formvorschriften auch eine behördliche
Überwachung gewährleistet werden
Schreibt das Gesetz für eine Erklärung die Schriftform vor, verlangt § 126 Satz 1 BGB
lediglich, dass die Urkunde von dem Aussteller durch Namensunterschrift eigenhändig unterzeichnet
ist.
Das Gesetz knüpft an das Schriftformerfordernis eine wesentliche Rechtsfolge: Mangelt es an
der vom Gesetz vorgeschriebenen Schriftform, sind die abgeschlossenen Verträge wegen Formmangels
nichtig (§ 125 BGB), entfalten also von Anfang an keinerlei Rechtswirkungen. Von dieser Regel gibt
es nur wenige Ausnahmen, bei denen durch Erfüllung oder Vollzug der Gesetzgeber ausdrücklich
eine Heilungsmöglichkeit vorsieht, wenn etwa die Unterschrift später eingeholt wird.
In diesem Zusammenhang sei z.B. der Kreditvertrag zu nennen, der nicht etwa online abgeschlossen
werden kann. Es handelt sich hierbei um ein Schuldversprechen im Sinne des §780 BGB und muss demnach
schriftlich abgeschlossen sein. Dabei ist die Erteilung des Versprechens in elektronischer Form
ausgeschlossen.
[Lösung schließen]
Aufgabe 11: Ein Reisebüro bietet online günstige Pauschalreisen zu den Kanaren
an. Ein Nutzer bucht eine dieser Reisen. Nach der Auftragsbestätigung stellt das Reisebüro
fest, dass die entsprechenden Reisen nur zu einem höheren Preis zu haben sind. Das Reisebüro
hatte in seinen Daten Vor- und Hauptsaison nicht richtig vermerkt. Kann von dem Nutzer der höhere
Preis verlangt werden?
Lösung
In dem beschriebenen Fall kann das Reisebüro vom Nutzer den höheren Preis
nicht verlangen. Begründung:
Die Vertragsparteien - Online-Reisebüro und Nutzer - haben einen Dienstvertrag abgeschlossen,
in dem das Reisebüro verpflichtet ist, die genannte Reise zu vermitteln und der Nutzer
verpflichtet ist, den zuvor vereinbarten Reisepreis zu zahlen. Dabei ist die Werbung auf der
Webseite des Reisebüros nicht als Angebot zu sehen, sondern lediglich als eine Aufmunterung
für den Kunden, ein Angebot abzugeben.
Der besagte Nutzer hat die Werbung gesehen und die Reise zum dort aufgeführten Preis gebucht -
insofern hat er eine Angebots- WE abgegeben. Kurz darauf bekommt er vom Reisebüro die
Auftragsbestätigung, bei der die Reiseleistungen und der Reisepreis aufgeführt sind,
die mit der zuvor erfolgten Werbung übereinstimmen - insofern eine Annahme- WE. Zu diesem
Zeitpunkt haben beide Vertragspartner übereinstimmende Willenserklärungen abgegeben und
ein Vertrag ist zustande gekommen.
Als es sich rausstellt, dass das Reisebüro sich bei der Preisberechnung geirrt hat, können
folgende Rechtspunkte berücksichtigt werden:
Mit einer neuen Preisberechnung macht das Reisebüro ein neues Angebot, wobei hier
der Kunde die Angebots- Annahme verweigern kann - es fehlt an zwei übereinstimmenden WE,
somit ist ein neuer Vertrag nicht zustande gekommen
Der Nutzer kann den bereits bestehenden Vertrag wegen Irrtums anfechten, da anzunehmen
ist, dass er bei der Kenntnis der Sachlage (tatsächlicher Preis) die WE nicht abgegeben
hätte
Das Reisebüro könnte den bestehenden Vertrag wegen Irrtums anfechten und sich
auf das fehlerhaftes Datenmaterial (die verarbeiteten Informationen - Saison und Preis - stimmen
nicht mit der Wirklichkeit überein) berufen - dies berechtigt aber nicht zur Anfechtung. Das
gleiche trifft auf die Anfechtung wegen fehlerhafter Software und die falsche Kalkulation zu.
Somit ist das Reisebüro an die erste WE gebunden und kann nicht vom Vertrag zurücktreten.
Insofern ist der Nutzer berechtigt, die Reise zum zuvor vereinbarten Preis zu buchen oder vom
bestehenden Vertrag zurückzutreten. Das Reisebüro kann weder den bestehenden Vertrag
anfechten noch dem Kunden einen neuen Vertrag aufzwingen und einen höheren Reisepreis verlangen.
[Lösung schließen]
Aufgabe 12: Im Fall eines Lebenssachverhalts mit Auslandsberührung sehen internationale
Abkommen sowie die nationalen Rechtsverordnungen vor, dass der betreffende Lebenssachverhalt nur einer
der betroffenen nationalen Rechtsverordnung unterliegen soll. Was ist das Zuordnungskriterium, nach
dem überwiegend vorgegangen wird, um den Lebenssachverhalt der einen oder anderen nationalen
Rechtsverordnung zuzuweisen?
Lösung
Grundstzlich können die an einem Vertrag beteiligten Personen frei aushandeln und damit
wählen, welches nationale Recht auf ihren Lebenssachverhalt anzuwenden ist. Wenn sich die
Vertragsparteien nicht über das anzuwendende nationale Recht einigen, kommen folgende Arten
von Zuweisungsregeln zum Tragen:
Bei personenorientierten Rechtsverhältnissen kommt es auf die Staatsangehörigkeit
und den Wohnsitz an (Personalitätsprinzip).
Bei gesellschaftsrechtlichen Beziehungen ist das Recht am Sitz des Unternehmens maßgeblich.
Im internationalen Warenkauf ist das UN-Kaufrecht (CISG) anzuwenden, wenn es nicht ausdrücklich
ausgeschlossen wurde und der Vertrag eine Berührung zu einem Vertragsstaat des Abkommens hat
(Internationales Wirtschaftsrecht).
Diese Regeln sind auch bei Vertragsabschlüssen im Internet anzuwenden. Das Verbraucherschutzrecht
darf nicht ausgeschlossen werden. Eine Rechtswahlklausel darf nicht dazu führen, dass dem
Verbraucher der Schutz des Staates entzogen wird, in dem er seinen Wohnsitz hat. Im Wettbewerbsrecht,
im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und im Wirtschaftsstrafrecht ist der Ort des
Handlungserfolgs für das anzuwendende Recht maßgeblich.
Vom anzuwendenden materialen Recht zu unterscheiden ist der Ort des Gerichtsstandes. Dieser kann
ebenfalls vertraglich durch eine Gerichtsstandsklausel vereinbart werden. Für außervertragliche
Handlungen begründet der Ort der Begehung die Zuständigkeit der Gerichte.
[Lösung schließen]
Aufgabe 13: Ein Informationsdienst mit Geschäftssitz in Deutschland
bietet die Nutzung seiner Datenbanken gegen Entgelt europaweit via Internet an.
Zugang zum Internet hat der Informationsdienst über den Server in Frankreich.
Ein spanischer Nutzer schließt mit dem Informationsdienst einen Vertrag über die
Nutzung der Datenbanken. Eine Rechtswahl wurde nicht vereinbart.
Wie viele Verträge können Sie erkennen?
Lösung
Es lassen sich hier folgende Verträge erkennen:
- deutscher Informationsdienst - französischer Provider
- spanischer Nutzer - deutscher Informationsdienst
[Lösung schließen]
Liegen Kauf- oder Dienstverträge vor?
Lösung
In beiden Fällen liegen Dienstverträge vor, wobei die eine Vertragspartei zur
Leistung der versprochenen Dienste verpflichten ist (1. Provider stellt Serverplatz zur Verfügung;
2. Informationsdienst erlaubt die Datenbanknutzung), die andere Vertragspartei die vereinbarte
Vergütung zahlen muss (1. Entgelt für Servernutzung; 2. Entgelt für Datenbanknutzung).
Ein Kaufvertrag ist in beiden Fällen ausgeschlossen, da die Vertragsparteien die Rechte am
Vertragsgegenstand nicht verlieren.
[Lösung schließen]
Sie haben die Wiener UN- Kaufkonvention und das europäische Vertragsrechtübereinkommen
kennen gelernt. Was ist anwendbar?
Lösung
In beiden Fällen ist das europäische Vertragsrechtsübereinkommen anzuwenden,
das alle internationalen vertraglichen Schuldverhältnisse betrifft, etwa Dienst-, Werk-
oder Maklervertrag. Wie bereits erläutert handelt es sich um die zwei Dienstverträge,
weshalb eben das europäische Vertragsrechtsübereinkommen anzuwenden ist.
Die Wiener UN- Kaufrechtsabkommen kommt hier nicht zum Tragen, da es ausschließlich die
international abgeschlossenen Kaufverträge betrifft, was hier nicht der Fall ist.
[Lösung schließen]
Welches Recht gilt und weswegen?
Lösung
Für die Servernutzung ist das französische Recht anzuwenden, da die
Serververmittlung (der eigentliche Kern des Vertrags) von Frankreich aus geschieht.
Im zweiten Fall - Datenbanknutzung - ist das deutsche Recht anzuwenden, da der Informationsdienst
seinen Sitz in Deutschland hat und die Leistungen europaweit anbietet. In beiden Fällen ist
das Sitz des Unternehmens maßgeblich
[Lösung schließen]